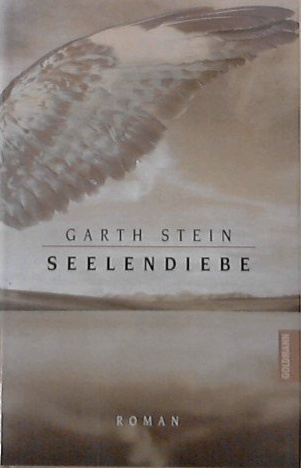Wie oft habe ich mich schon über ein eigentlich spannendes Schauerbuch geärgert, nur weil die unerklärlichen Phänomene dann auf einen alten Indianerfriedhof zurückzuführen waren? Angefangen mit Friedhof der Kuscheltiere, was ich mit dreizehn Jahren lesen musste, um die Freundschaft einer Mitschülerin zu gewinnen (und sie war es ebenso wenig wert wie das dazugehörige Buch), habe ich da eine Aversion entwickelt. Keine Indianerbücher mehr für mich. Bis ich jetzt plötzlich ein solches Buch in Händen halte, über vierhundert Seiten dick und doch gelesen binnen eines Tages. Und alles nur wegen eines Covers, das nicht einmal wirklich gut zum Inhalt passt, und wegen eines Titels, der dem englischen Original nicht das Wasser reichen kann.
Raven stole the Moon heißt dieses Buch im Original – ein sehr schöner Titel, und vermutlich hätte er mich doch weniger angesprochen als Seelendiebe. Dazu ein Cover, bei dem sich ein paar gespiegelte Flügel über ein undefiniertes beiges Gewässer beziehungsweise Vorder- und Rückseite spannen – Christoph zumindest lachte sehr, als er das Buch sah, und meinte, er wisse genau, warum ich mir das ausgeliehen hätte: Erinnert es doch irgendwie sehr an das Cover meines ersten selbstverlegten Buches, Engelsschatten, und der Titel passt auch noch in die Richtung. Dabei sind die Flügel wirklich irreführend. Zwar geht es auch ein wenig um Rabe, Totem der Tlingit-First Nation, aber die eigentlichen Stars dieses Buches sind die Otter. Was sich wieder gut trifft, denn ich mag Otter sehr. Und noch besser ist, dass die Tlingit ihre Toten verbrennen: Darum haben sie auch keine Indianerfriedhöfe.
Tatsächlich erlebte ich mit diesem Buch ein Wiedersehen mit meinen Lieblingsindianern, wenn ich so etwas haben sollte. In einem Völkerkundebuch meiner Jugend (eigentlich der Jugend meiner Mutter), So lebt man anderswo, mochte ich am meisten den Bericht über die Haida, die wie die Tlingit an der Westküste Alaskas in Häusern mit riesigen Totempfählen lebten. Und so wenig ich auch Traumfänger und Indianerfriedshofsschmuh mag, für Totempfähle kann man mich begeistern. Auch, wenn die modernen Indigenen in normalen Häusern wohnen, war ich doch sehr froh, in Seelendiebe einem solchen Totempfahlbau zu begegnen. Es trifft sich gut, dass der Autor selbst von den Tlingit abstammt – so behauptet zumindest der Klappentext, ohne den Grad der Verwandtschaft näher zu bestimmen, aber ich bin geneigt, ihnen zu glauben, denn das Buch macht einen solide recherchierten und durchaus fundierten Eindruck, sofern man das als Mitteleuropäerin beurteilen kann.
Das Buch, ein erfreulich unkitschiger und erstaunlich guter Roman, erzählt die Geschichte einer Katharsis. Die indianische Mythologie liefert hierfür das Gerüst und den Hintergrund, doch Garth Stein ist ein zu begabter Autor, um sie zum eigentlichen Thema zu machen. Ein Kind ertrinkt im Urlaub, die Eltern kommen nicht darüber hinweg, schon weil nie eine Leiche gefunden wird, und als die Mutter Jahre später an den Ort der Tragödie zurückkehrt, geschehen unheimliche Dinge: Das ist die Zusammenfassung des vor zwei Jahren gefloppten Horrorfilms The Dark, und die von Seelendiebe, womit die Parallelen aber auch schon wieder vorbei sind. Film spielt in Wales, Buch in Alaska; Film habe ich nicht gesehen, Buch aber gelesen. Die Handlung war leicht vorhersehbar und hat mich an keiner Stelle wirklich überrascht – ab dem Moment, wo ich die Katharsis als zentrales Motiv erkannte, wusste ich, worauf es hinauslaufen und wie es enden sollte, und so war es dann auch. Wobei es dann doch ganz leichte Reminiszenzen an Friedhof der Kuscheltiere gab, ohne dass meine Befürchtungen in dieser Hinsicht eingetreten wären…
Das dicke Buch – mehr als vierhundert Seiten – umspannt nur wenige straff erzählte Wochen an Handlung, aber der Autor versteht sich meisterlich darauf, mit den Zeitebenen zu spielen. Rückblenden werden eingeflochten, dass man sie für parallele Handlungsstränge hält, das Vergangene behutsam ausgebreitet, so dass der Leser an keiner Stelle mit einer langatmigen Vorgeschichte niedergeknüppelt wird: Bobby ist tot, soviel erfahren wir schnell, gleich am Anfang, ertrunken, aber wie? Und vor allem: Durch wessen Schuld? Wer ist gut? Wer ist böse? Und gibt es Gut und Böse überhaupt? Das sind die Fragen, um die das Buch kreist, ohne sie jemals wirklich zu beantworten – wo es keine Antwort gibt, sicher die beste aller Lösungen.
Überhaupt ist es erfreulich in Zwischentönen gehalten: Weder sind die Indigenen die Edlen Wilden, noch die Weißen gierige und ungläubige Schufte; der mysteriöse Schamane hat nicht nur einen Doktortitel, sondern auch eine unangenehm arrogante Seite, und der kalt-gefühlslose Ehemann sucht vielleicht selbst nur einen Weg, mit dem Verlust des Sohnes zu leben. Von der Heldin mit indigenen Wurzeln ganz zu schweigen, denn sie ist zwar eine gefeierte Schönheit mit üppigen Brüsten, aber ein psychisches Wrack. Eine einzige Person ist vom ersten bis zum letzten Auftritt unsympathisch angelegt und kann dabei nicht überzeugen, bleibt flach und schematisch.
Nur wenige Stellen wirken unüberzeugend: So sollte man meinen, eine derart besessene Frau würde in jedem Jungen passenden Alters gleich den verlorenen Sohn wähnen – statt dessen meint sie irgendwann recht beiläufig, dieses Kind habe Bobby doch sehr ähnlich gesehen: Tatsächlich war es sein Ebenbild, und da wäre sicher eine andere Reaktion angemessen gewesen: Die aber nicht in die Dramaturgie gepasst hätte, denn die Erkenntnis kommt bewusst spät – als ob nicht jeder Leser das längst geahnt hätte!
Es sind Momente wie diese, an denen man dem Autor seine Unerfahrenheit anmerkt. Manchmal traut er dem Leser zu wenig zu, verzettelt sich, verliert sich in geschwätzigen Dialogen, und manches hätte man getrost weglassen oder streichen können. Das Buch ist unnötig dick und verliert gegen Ende nicht an Spannung, aber an Stringenz: Im hinteren Viertel gibt Stein seinen sorgfältigen Aufbau dran, wird fahrig und lässt die Perspektiven ineinanderfließen, als hätte er es eilig, endlich zum Ende zu kommen.
Ich empfehle dieses Buch trotz dieser leichten Einschränkungen gerne weiter, denn es ist bei aller Vorhersehbarkeit spannend und gut zu lesen, auch offenbar gut übersetzt, denn es hatte keine Stellen, über die ich mich geärgert hätte, bis auf eine Kleinigkeit, die wohl Geschmacksache ist: Der Namen des Totems wird im Buch konsequent auf Englisch wiedergegeben – Raven – obwohl durch Übersetzung der Totemcharakter besser rübergekommen wäre und Rabe sicher auf Tlingit einen ganz, ganz anderen Namen hat.
Empfehlen möchte ich dieses Buch insbesondere Rollenspielern, die wie ich zufällig wieder das Spielerhandbuch von Changeling: The Dreaming in die Finger bekommen haben. Denn dort finden sich die Regeln, wie man die indianische Geisterwelt im modernen Rollenspiel umsetzen kann, und wenn sich auch die Kushtaka selbst nicht unter den spielbaren Figuren finden, kann man doch mit diesem Buch Seelendiebe im Verhältnis Eins zu Eins als Rollenspielhintergrund umsetzen. Ich zumindest habe jetzt endlich Lust bekommen, mir das lange Kapitel über die Nunnehi durchzulesen.