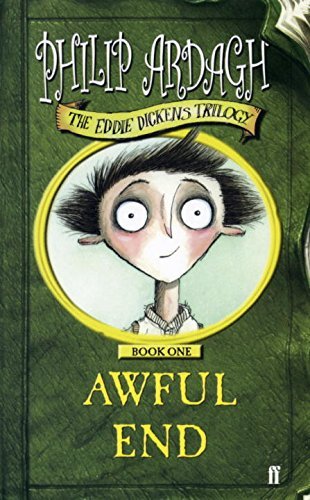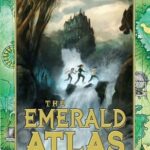Nachdem ich mich mit dem Yak-Buch der humoristischen Kinderliteratur zugewandt hatte, fiel mir ein weiteres Buch ein, das ich mir irgendwann im letzten Jahr angeschafft habe und, obwohl es ziemlich dünn ist, nie zu Ende gelesen. Nach einigem Suchen tauchte es unter dem Regal auf, wo es unbemerkt hin gerutscht war, so dünn war es, und eine gute Stunde später hatte ich es dann auch gelesen. Aber damit fangen meine Probleme erst an: Ich habe kein Problem damit, ein Buch von 136 Seiten zu rezensieren, aber wenn es dann keine Handlung hat, wird es doch etwas schwieriger. Trotzdem, ich will es versuchen – schließlich kann ich Awful End mit einem der großartigsten Kinderbücher aller Zeiten vergleichen. Und genau das werde ich tun.
Gestoßen bin ich auf dieses Buch über ein anderes Werk des Autors Philip Ardagh, das ich in Kanada in einer Wühlkiste gestoßen bin, und da es mir The Not-So-Very-Nice Goings On at Victoria Lodge ausgesprochen gut gefallen haben – ich würde es rezensieren, aber es hat noch weniger Handlung als dieses jetzt und ist ohne seine Illustrationen noch nicht einmal zu beschreiben – wollte ich wissen, was dieser Mann von feinem Humor noch an Werken auf den Markt gebracht hat. So kam ich auf die Eddie Dickens-Trilogie, und auch wenn ich kurz davorstand, mir gleich alle drei Bücher auf einmal zu bestellen, habe ich es dann doch beim ersten Band beruhen lassen. Und darüber bin ich letztlich froh. Denn auch wenn der Autor so viel Wortwitz hat, dass man für die deutsche Übersetzung immerhin den großen Harry Rowohlt gewinnen konnte, und auch wenn das Buch illustriert ist von David Roberts, dessen witzige Zeichnungen mich an Tony Ross erinnern, ist es am Ende doch weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Und lachen musste ich auch nicht.
Auf den ersten Blick hat Awful End vieles mit Alice’s Adventures in Wonderland zu tun, und das nicht nur, weil beide Bücher auf Nonsens und Wortspiele setzen. Auch die Entstehungsgeschichten kann man vergleichen: Lewis Carroll erzählte die Geschichte von Alice seinen drei kleinen Freundinnen, und Philip Ardagh schrieb Eddie Dickens für seinen Neffen im Internat. Beides war also eigentlich nicht für ein größeres Publikum gedacht, und wenn ich ehrlich bin, merkt man das auch beiden Werken an. Nun bin ich mit den Hintergründen von Alice sehr gut vertraut und kann viele der kleinen Anspielungen zuordnen, was das Buch zwar nicht witziger macht oder sinnvoller, aber doch beim Verständnis hilft. Was Ardagh und seinen Neffen angeht, habe ich nichts als die Aussagen des Autors. Und Alice ist ein Buch von solcher Brillanz, solcher sprachlicher Schönheit, dass man ihm letztlich verzeiht, dass es keinen richtigen Plot hat und nur von verschrobener Episode zu Episode hüpft, ohne roten Faden, dafür aber mit unvergesslichen Figuren und unerreichtem Witz. Es ist eines meiner aller-allerliebsten Bücher.
Awful End versucht das gleiche, aber es scheitert. Die Geschichte des kleinen Eddie Dickens, der zu seinem verrückten Onkel geschickt wird, um sich nicht bei den kranken Eltern anzustecken, und der, statt in dem titelgebenden Haus Awful End anzukommen, irrtümlich im Waisenhaus landet, hätte eine Menge hergegeben – wenn sich nicht der Autor stattdessen selbstverliebt im eigenen Witz suhlen und seine durchaus vorhandenen Chancen ungenutzt vertun würde. Wo Alice immer in Bewegung ist und ein Feuerwerk an Szenen, Slapstick und verschrobener Figuren über den Leser hereinbricht, versucht Ardagh, bei vergleichbarer Länge mit einem Halbdutzend Charaktere auszukommen, die sich dazu auch noch alle zu sehr ähneln, und verliert dadurch allen Schwung. Dazu durchbricht er so oft die vierte Wand, dass dieses praktisch nicht mehr existiert, was zusätzlich Tempo aus der Geschichte nimmt.
Dabei ist Ardagh per se kein schlechter Erzähler, wenn er ironisch distanziert und gleichzeitig mit großer Ernsthaftigkeit von einer Zeit erzählt, in der Bettwäsche aus braunem Papier gemacht wird und die niedersten Mägde unter der Kellertreppe schlafen müssen. Und von Puns, köstlichen Wortspielen, versteht er auch einiges. Aber wann immer eine Gelegenheit kommt, etwas aus dem Plot zu machen, erfolgt stattdessen eine Vollbremsung, ein Exkurs, ein Umweg, oder ein Schnitt. Und da der Großteil des Buches sich im Inneren einer fahrenden Kutsche abspielt, was die Akteure zu weitgehend statischem Sitzen verurteilt, dauert es gefühlte Ewigkeiten, bis überhaupt etwas passiert. Da helfen auch kein durchgeknallter Impressario und ein ausgestopftes Hermelin von ungeklärtem Geschlecht – dafür wird der potenziell actionreichste Teil der Geschichte, in der Eddie aus dem Waisenhaus entkommen muss, im Eilverfahren abgehandelt, dass man auf diesen Teil der Geschichte ebenso gut hätte verzichten können.
Der Hauptunterschied zwischen Eddie und Alice ist der, dass Eddie keine Fragen stellt und alles klag- und kommentarlos hinnimmt, während Alice in Anwesenheit der durch und durch verrückten und kindischen Wunderlandbewohner in die Opposition geht und die erwachsene Stimme der Vernunft darstellt, nichts als gegeben nimmt und sich titelgebend wundert – so kommen Kontrast und Konflikt in die Geschichte, die bei Eddie Dickens völlig fehlt. Und nur Pun an Pun zu reihen, macht eben noch kein gutes Buch. Und so schön es auch ist, über Verrückte zu lachen – vor allem, wenn man selbst verrückt ist, wenn auch nur zu zwanzig Prozent, wie mir das Versorgungsamt auf meinen Schwerbehinderungsantrag hin zertifiziert hat – reicht auch das noch nicht aus. Dafür wiederholt sich zu viel, Witze werden zu Tode geritten, und anstatt dass ich mir die beiden Folgebände der Trilogie anschaffe, freue ich mich, dass dieses eine Buch zumindest im Regal nicht viel Platz wegnimmt. Und Harry Rowohlt sollte stattdessen endlich mal versuchen, Alice zu übersetzen.