Von den Büchern, die ich mir um 2011, als ich meinen letzten größeren Leseschub hatte, gekauft habe, ist The Girl with Glass Feet sicherlich eines der Hübschesten. Das Cover in verträumt-verschneiten Grautönen, dazu ein silberner Seitenschnitt, lange bevor Farbschnitt ein Thema wurde: Dieses Buch verspricht eine zart-zerbrechliche, phantastisch-romantische Liebesgeschichte, und nachdem das Buch gut und gern zwölf Jahre ungelesen im Regal gestanden hat, erschien es mir wie eine gute Wahl für kalte Wintertage. Selten habe ich mit einem Buch mehr daneben gelesen.
Der Klappentext spricht die gleiche Sprache wie das Cover und lügt dabei auch nicht. Auf der Inselgruppe St. Hauda’s Land gehen merkwürdige Dinge vor: ein Tier geht um, dessen Blick alles, was er berührt, weiß wie Schnee macht, seltsame Tiere flattern umher, und Ida Maclaird wird, von den Zehen aufwärts, zu Glas. Kann der Außenseiter Midas Crook sie mit seiner Liebe retten? – ja, das klingt wie Romantasy vom Feinsten. Ist es aber nicht. Vom Genre her würde ich es bestenfalls unter »magischer Realismus« einsortieren, eher noch unter klassischer Belletristik. Und auch wenn eine Liebesgeschichte im Mittelpunkt des Buches steht, war es für mich doch an keiner Stelle romantisch.
Dabei ergänzen sie sich eigentlich perfekt. Midas ist ein Mann ohne Körper, ein schwebendes Auge, das die Welt durch die Linse seiner Kamera als stiller Beobachter sieht, außerhalb der Dinge und des Lebens, der im Verlauf der Handlung körperlich werde muss. Ida wiederum ist dabei, genau das – ihren Körper – zu verlieren. Beide durchleben eine Metamorphose: Midas hin zum Menschen, Ida hin zum Objekt. Und um die Objektwerdung einer Frau dreht sich das ganze Buch. Nicht Ida ist die Hauptfigur, Midas ist es, und weite Teile des Buches werden aus Männersicht erzählt: Ida, die immer farbloser und durchsichtiger wird, mag Dreh- und Angelpunkt der Geschichte sein, doch sie bleibt passiv, eine »Damsel in Distress«, die es zu retten gilt, ein Objekt.
Da ist zum einen Midas, der sich aus dem Schatten seines ebenso lieblosen wie dominanten Akademikervater lösen muss, dessen Selbstmord er als Jugendlicher hat mitansehen müssen. Da ist der Sonderling Henry, der Mottenflügelrinder züchtet – ebendiese seltsamen geflügelten Kreaturen, die mir der Klappentext versprochen hat – und über Jahre in Midas‘ Mutter verliebt war. Und da ist Carl, Akademikerkollege von Midas‘ Vater und, als alter Bekannter von Idas verstorbener Mutter, deren Gastgeber auf St. Hauda‘s Land, und weil der unsterblich in Idas Mutter verliebt war, erstreckt sich diese Besessenheit bald auf die Tochter.
Allen dreien wird viel Erzählzeit eingeräumt, jeder bekommt seine diversen Rückblenden, wird differenziert und meistens alles andere als sympathisch geschildert. Vor allem Carls Perspektive liest sich durch die Bank unangenehm bis ekelhaft, der Blick des alten Mannes – er ist tatsächlich erst in meinem Alter, aber das entschuldigt nichts – auf die junge Frau macht keinen Spaß, und seine Incel-Phantasien sind nicht das, was ich gerne lesen möchte. Im Vergleich dazu hat die immer mehr verglasende Ida wenig Zeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Wir erfahren Oberflächlichkeiten über sie, bekommen immer wieder aufs Brot geschmiert, wie hübsch sie in ihrer monochromen Art ist, aber sie hat nur wenig Substanz, und in ihre Perspektive mischen sich immer wieder Absätze aus Sicht einer der anwesenden Männer. Schon der Titel des Buches – auch auf Deutsch als Das Mädchen mit den Gläsernen Füßen erschienen – reduziert sie, die erwachsene Frau, auf ein Mädchen – auch sonst darf sie niemals eigenständig agieren.
Dazu kommen immer störendere Grenzüberschreitungen: Midas, welcher der schlafenden Ida die Socken von den Füßen zieht und dann Fotos ihrer gläsernen Füße schießt, wird sofort verziehen, und Ida ist nur froh, endlich mit jemandem über ihren Zustand sprechen zu können – oder Carl, der einmal mitangesehen hat, wie sich Idas Mutter Freya das Knie aufgeschlagen hat und der handgreiflich wird, um einen Blick auf Idas Beine zu erhaschen – was Ida nur hilflos davonrennen lässt, wo sie von Midas gerettet werden kann. Keinmal darf Ida sich selbst behaupten, keinen Lösungsansatz findet sie selbst, sie ist ein passiver Spielball für Männerphantasien, und das macht einfach keinen Spaß.
Dabei finde ich den Ansatz wirklich faszinierend. Glas ist ein Motiv, das mich immer schon fasziniert hat, ich mag Glastiere und Buntglasfenster und überhaupt Dinge aus Glas, und da schien das Buch des Briten Ali Shaw bei mir offene Türen einzulaufen – doch das Lesen wurde immer mehr zum Ärgernis. Selten hatte ich ein so klares »Männer schreiben Frauen«-Empfinden wie bei dieser Geschichte. Männer sind in The Girl with Glass Feet verkopfte Wesen, Frauen werden von ihren Gefühlen regiert und haben die Macht, verkopfte Männer zu heilen – und so ist es auch nicht die glasige Ida, die am Ende gerettet werden muss, sondern Midas.
Der muss, um Idas würdig zu sein, erst einmal zum Mann werden, was bedeutet, dass er lernen muss sich zu prügeln und Körperlichkeiten auszutauschen: Dinge, denen er mit Hilflosigkeit und letztlich auch Unwillen begegnet. Midas ist sicher nicht glücklich, wo es um das Erbe seines Vaters geht, das gestörte Verhältnis zu seiner Mutter, die Schuldgefühle um den Tod der Frau seines besten Freundes: Aber wo das Buch den Heilungshammer ansetzt, ist seine Körperlosigkeit, die andere Leute mehr stört als ihn. Um Ida zu gewinnen, muss er ein anderer werden, und für Ida tut er das dann auch – statt dass sie einander nehmen, wie sie sind. Midas verzweifelt an der Vorstellung, Ida an das Glas zu verlieren, Ida daran, dass Midas sie weder küssen noch umarmen will: Das eine schreit nach Akzeptanz, das andere muss sich ändern, aber Shaw vertauscht die Seiten, will heilen, wo es nichts zu heilen gibt. Der neurodivergente Außenseiter kann nur geliebt werden, wenn er sich dem Status Quo anpasst: Was ist das denn bitte für eine Botschaft?
In seinen schlechtesten Momenten wird The Girl with Glass Feet küchenpsychologisch. Wenn Midas‘ Phobien per Konfrontation geheilt werden müssen – aus Liebe ist er bereit, alles über sich ergehen zu lassen – liest sich das sehr unangenehm. Was er bräuchte, um den Tod seines Vaters zu verarbeiten, ist professionelle Hilfe, nicht eine Freundin mit Heilerkomplex, die ihn gerne zu einem anderen machen möchte. Ida hingegen ist so geduldig, so abgeklärt, bei ihr gibt es nichts zu konfrontieren – sie schleppt sich auf ihren Krücken vorwärts, aber sie sucht keine Heilung und eigentlich nicht einmal Antworten auf die Frage, was ihr da widerfährt; bestenfalls kann man ihr eine leichte, passive Neugier unterstellen, aber das war’s auch schon, und wer darauf wartet, dass sie endlich einmal zu wüten beginnt gegen ihr Schicksal, wartet vergeblich.
Auch die Nebenfiguren machen keinen Spaß. Frauen sind in lieblosen Ehen gefangen, gegen die sie niemals aufmucken – so wie auch Ida niemals wütet gegen das, was ihren Leib befallen hat – und sind allesamt vor ihrer Zeit vergreist. So lebt Midas‘ Mutter mit ihren irgendwas um die sechzig Jahren schon in einer Seniorenresidenz, während Emiliana, die Heilpraktikerin, die auf Ida losgelassen wird, als verblühte Schönheit mit Falten und schütterem Haar beschrieben wird (sie ist, wie ich, Ende vierzig). Selbst die siebenjährige Denver, Tochter von Midas‘ besten und einzigem Freund, ist ein so greisenhaft-weises Geschöpf, dass man den Autor fragen möchte, ob er schon mal eine Siebenjährige getroffen hat: Das ist kein altkluges kleines Mädchen, sondern geht in der Wahl ihrer Worte und ihrer Themen so weit ab vom Verhalten echter Kinder, wie das nur möglich ist.
Gelungener als die Schilderung der Figuren ist die des Settings. Das fiktive St. Hauda’s Land, eine Inselgruppe, von der ich vermute, dass sie ungefähr auf Höhe der Orkneys liegen muss, wird greifbar mit seinen winterlich verfrorenen Sümpfen, seinen kleinen Städten und seinen Kirchen mit verschossenen Buntglasfenstern, auch wenn alles etwas Unwirkliches hat. Da lösen sich an der Küste die Quallen in einem Wirbel aus Lichtern aus, da tauchen etwas weiter draußen die Narwale um die Wette, und mittendrin macht dieses geheimnisvolle Wesen, das alles weiß werden lässt, die Moore und Wälder unsicher: Aber gerade diese Elemente wirken verkrampft, haben keinen echten Bezug zur Geschichte und wirken mehr wie ein Versuch, etwas mehr Phantastik unter eine Geschichte zu heben, deren einziges echtes phantastische Element Ida Maclairds Metamorphose ist. So bleiben auch Henrys Mottenflügelrinder ein kurioser Fremdkörper, ein surrealistisches Element in einer ansonsten eigentlich schmerzlich realistischen Geschichte.
Das Glas hätte da völlig ausgereicht – als metaphorisches Element, um eine Geschichte vom Loslassen zu erzählen, von Trauerarbeit und Akzeptanz. So bleibt die Handlung vorhersehbar, so durchsichtig, wie Idas Körper es zunehmend wird, und endet, von einem eher überflüssigen Epilog mal abgesehen, genau so, wie ich es erwartet hätte. Kein schlechtes Ende, weniger ärgerlich als anderes, das hätte sein können, aber es sollte schmerzlich sein und hat mich stattdessen völlig kalt gelassen. So war die ganze Lektüre ein zähes Stück Arbeit, Tag für Tag habe ich mein vorher abgestecktes Lesepensum abgearbeitet, und was mich bei der Stange gehalten hat, war nicht der Wunsch zu wissen, wie es weitergehen würde, sondern die Aussicht, am Ende eine Rezension dazu schreiben zu dürfen, und ohne die hätte ich das Buch wahrscheinlich sehr früh aus schierer Gleichgültigkeit wieder beiseitegelegt.
Was bleibt also am Ende der knapp dreihundert Seiten? Trübsinn und Ödnis. Vielleicht hätte ich das Buch besser im Sommer gelesen, wo die Schilderungen der nasskalten Inseln mich erfrisch hätte – so hat mich das Buch in der von Haus aus schon kalten und dunklen Umgebung nur noch weiter runtergezogen. Am Ende bleibt ein unangenehmer Nachgeschmack, den der Sexismus, der sich durch das ganze Buch zieht, hinterlassen hat, und die hier verbreitete Ansicht, dass neurodivergente Menschen geheilt und gleichgemacht werden müssen, um lieben und leben zu dürfen. Das war nicht zart, nicht zerbrechlich, nicht phantastisch und nicht romantisch – das war einfach nur ein ärgerliches Buch.

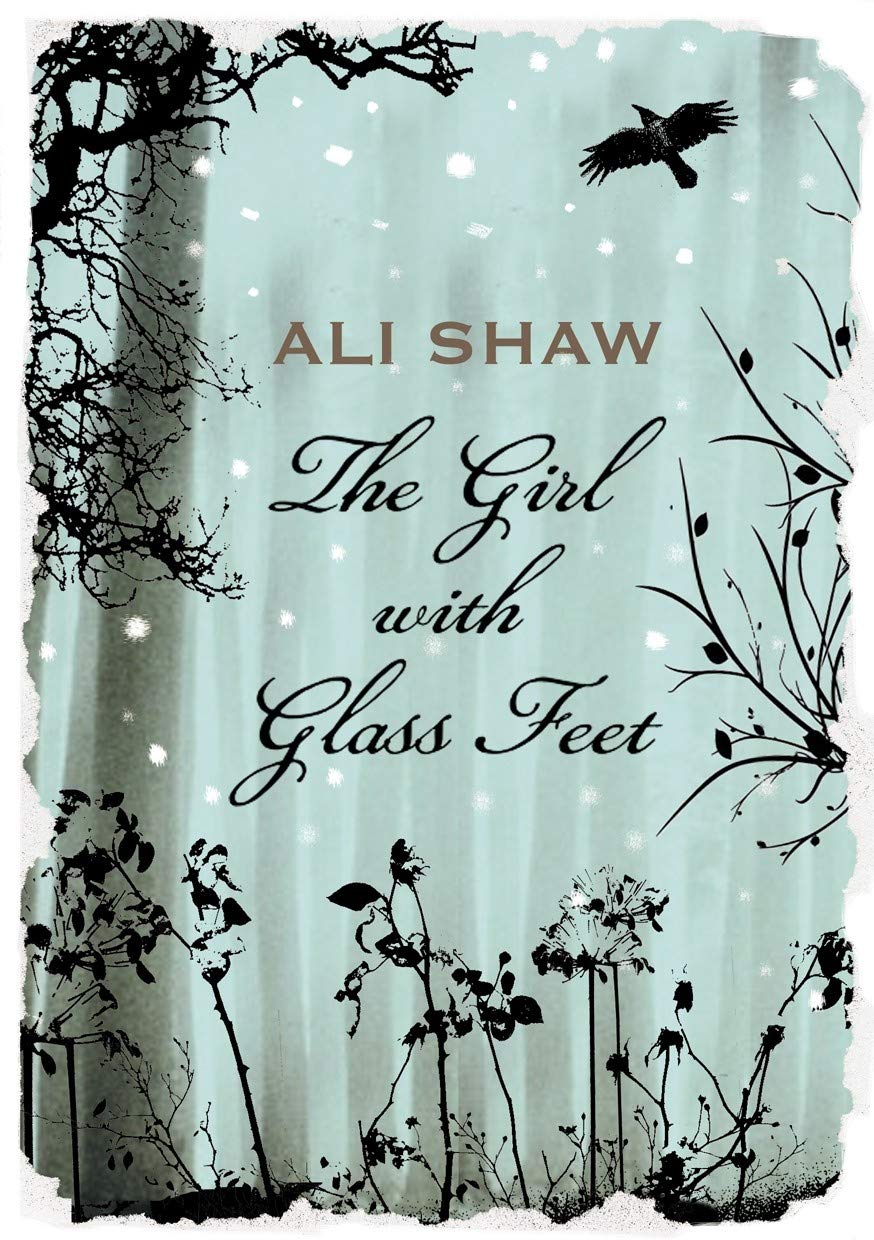




Kommentare