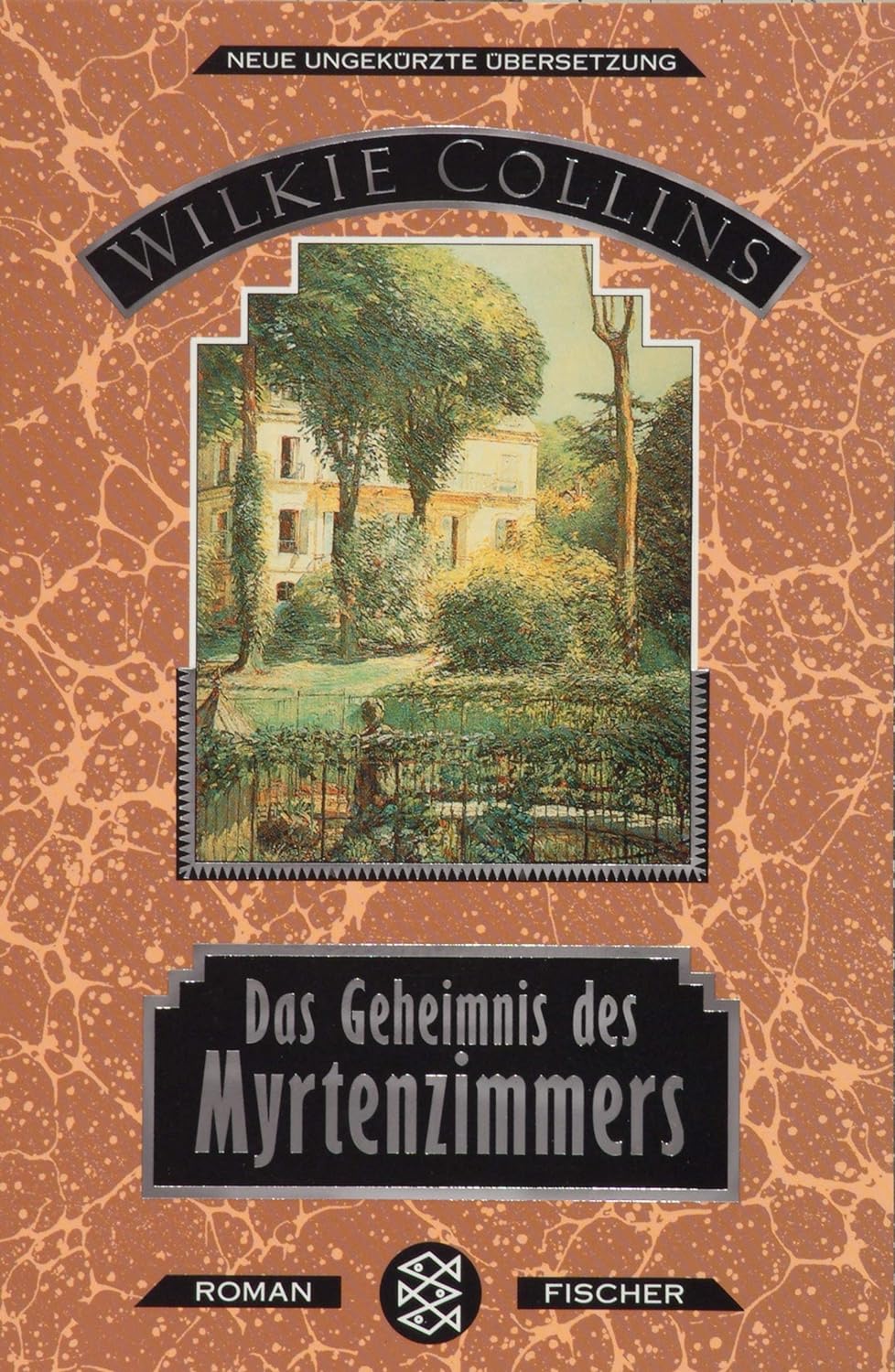Wer Bücher über morsche Herrenhäuser und dunkle Familiengeheimnisse liebt, der kommt an Wilkie Collins nicht vorbei. Der viktorianische Engländer machte das Genre der bekannten und besonders bei Frauen beliebten Gothic Novels zu Mystery Thrillern – und nicht nur hat sich diese Bezeichnung bis heute gehalten, Collins ist auch immer noch ihr wertvollster und wichtigster Vertreter. Selbst wer Mystery-Romane gemeinhin als Schund bezeichnet, hat meist noch den Anstand, zumindest Wilkie Collins davon auszunehmen – zumindest Die Frau in Weiß gilt als ein unverzichtbarer Klassiker der Spannungs- und Abenteuerliteratur, und mit dem Buch Der Monddiamant liefert Wilkie Collins einen richtigen Krimi, bevor es das Genre als solches überhaupt gab.
Und auch ich bin natürlich nicht an diesem Autor vorbeigekommen, und wenn ich auch selbst als Mystery-Leserin immer nur Spott für das Genre übrighatte, war doch auch ich immer bereit, Collins zu schonen und zu loben. Ich erinnere mich noch, wie ich als Oberstufenschülerin während einer Freistunde auf einer Bank in der Fußgängerzone hockte und völlig selbstvergessen in der Frau in Weiß schmökerte, bist ich nach guten zweihundert Seiten des doppelbändigen Werks auf und zur Rathausuhr blickte und begriff, dass ich gerade auch noch die nächste Stunde verpasst hatte… Oder wie mich ich als junge Studentin glühenden Herzens durch Der Rote Schal schlang, gefesselt und stets den Tränen nahe…
Als ich mir dann als Buchhandelsazubi einen Titel aus dem Fischerverlag aussuchen durfte – es muss eine Leseexemplaraktion oder etwas in der Art gewesen sein – entschied ich mich ohne zu zögern für die Neuausgabe von Das Geheimnis des Myrtenzimmers – ein bildschön aufgemachtes Taschenbuch mit pseudo-marmoriertem Einband, erschienen in der Reihe Bibliothek der Klassischen Abenteuerliteratur – aber was war dann? Hatte ich Angst, das schöne Buch beim Lesen zu beschädigen? Oder fürchtete ich wieder die Enttäuschung? Jedenfalls las ich das Buch nie. Bis jetzt. Und es hätte es fast geschafft, mich zu enttäuschen. Bis kurz vor dem Schluss war ich auf der Klippe, Wilkie Collins von seinem hohen Thron zu stoßen und in Richtung Schund zu schubsen. Aber nur bis kurz vor den Schluss. Collins hat es wieder einmal geschafft, mich vom Gegenteil zu überzeugen.
Von einem Buch mit dem klangvollen Titel Das Geheimnis des Myrtenzimmers erwartet man – mehr noch als von einem The Dead Secret, so der Originaltitel – ein geheimnisvolles Herrenhaus mit Räumen, die seit sechzig Jahren ungenutzt sind, ein dunkles Geheimnis, und eine ebenso unerschrockene wie gutaussehende Heldin, die dem Ganzen auf den Grund geht, an ihrer Seite ein prächtiger Mann zum Heiraten. Und tatsächlich ist all dies in dem Buch enthalten, und so könnte es sich nahtlos in eine Reihe stellen mit dem Haus der Sieben Elstern oder dem der Kolibris – wenn, ja wenn es nicht von Wilkie Collins stammte. Denn bei Wilkie Collins steht nicht die Aufklärung des Geheimnisses im Mittelpunkt, sondern das Geheimnis selbst. So sehr, dass man es schon fast als Hauptfigur bezeichnen kann.
Collins nutzt immer wieder das gleiche Strickmuster: A weiß etwas, darf es aber B nicht sagen, aus Angst, B damit das Herz zu brechen. Da sich aber die Wege von A und B immer wieder kreuzen, geht A an der Bürde des Geheimnisses zugrunde. So weit, so einfach und genial. Nicht das junge Glück der drallen Heldin interessiert, sondern die gequälte Seele, die gehetzte Kreatur, das Leid. Kein Buch von Collins ohne beschädigte Personen, Qualen und Krankheit. Mir kommt das sehr gelegen, ich will auch nichts von gesunden Leuten lesen – hier haben wir also die unglückliche Zofe, die im ersten Kapitel das dunkle Geheimnis der sterbenden Herrin niederschreiben muss mit der undankbaren Aufgabe, diesen Brief an den Herrn Kapitän und Gemahl zu übergeben. Sie bringt es nicht über sich – sonst wäre das Buch ja schon vorbei und das Geheimnis kein Geheimnis mehr – sondern versteckt den Brief im (natürlich!) Myrtenzimmer und verschwindet. Der Leser weiß, dass sie damit nicht so leicht davonkommt, und dass die bezaubernde Rosamund das Geheimnis früher oder später erfahren wird, damit Sarah endlich Erlösung findet –
Und da begann mein Hadern mit dem Roman. Um die Spannung aufrechtzuerhalten, hütet Collins das Geheimnis vor dem Leser, macht aber unentwegt Andeutungen, die nur einen plumpen Schluss zulassen. Und so bangte ich bis zum Ende: Ist es das, was ich seit dem ersten Kapitel ahnte, dann ist es ein schlechtes Buch. Sollte es aber doch anders sein, ist das Buch gut. So zwang ich mich weiterzulesen, auch als ich die Lösung fest vor Augen glaubte – und wurde erfreulich überrascht. Es ist nicht so, wie ich dachte. Es ist so ähnlich, aber doch anders. Unerwartet genug, um das Buch für mich zu einem guten Buch zu machen. Der Schluss natürlich verkitscht. Aber doch nett. Und der herzensgute, unerträglich aufrechte und leicht dünkelhafte Gemahl der Rosamund, durch Krankheit erblindet – das gibt dem Plot nochmals psychologische Tiefe, denn nun muss auch Rosamund eine harte Gewissensentscheidung treffen – ist am Ende immer noch blind.
Bei Collins kann man keine plötzliche Genesung erwarten. Aus seinen anderen Büchern erinnere ich mich lebhaft an röchelnde Schwindsüchtige und ausgezehrte Depressive. Für jeden, der Abgründe und Krankheiten sucht, ist in diesen Büchern etwas dabei. Und das macht das Mitleiden und Mitfiebern nur umso leichter. Nicht mit Rosamund will man sich identifizieren, sondern hofft und bangt mit Sarah um die Wahrung des Geheimnisses – obwohl man die ganze Zeit über weiß, dass nur die Offenbarung sie retten kann. Erlösung durch Aufrichtigkeit ist das Thema, dass sich durch Collins’ umfangreiches Gesamtwerk zieht. Wer die Wahrheit spricht, dem wird verziehen. Und die Last unbekannter Schuld wiegt schwerer als jede mögliche Strafe. Fast wie bei meinem Freund Dostojewskij…
Obwohl das Myrtenzimmer mit seinen knapp 400 Seiten nur halb so dick ist wie Die Frau in Weiß oder Der Rote Schal, bleibt Collins viel Platz für Geschwätzigkeit, die oft überflüssig erscheint – die Charaktere sind mit so viel Liebe und Tiefe ausgearbeitet, dass es schon fast wieder zu viel des Guten ist, denn ich will wissen, wie es mit der Geschichte weitergeht und mich nicht durch seitenlange Charakterisierungen des Pfarrers von Long Beckley, seiner drei Kinder und seines magenleidenden Hausgastes arbeiten – aber wer die Geduld hat, sich auf dieses Panoptikum einzulassen, der wird wiederum belohnt mit plastischer Farbigkeit, welche die Lektüre zu einem viktorianischem Genuss macht. Am Ende nimmt man eher der zeitgenössischen Literatur ihre moderne Hast übel als Collins seine Detail- und Nebenfigurenverliebtheit.
Nur an der neuen Übersetzung von Rosemarie Gramsch habe ich ein wenig auszusetzen – sie ist sicherlich gut zu lesen, schön formuliert und nicht mal schlechter als das Original, aber wenn ich ein Buch aus dem Neunzehnten Jahrhundert lese, dann soll es auch im Deutschen die Sprache des Neunzehnten Jahrhunderts sprechen, als ein neugeborenes Kind noch kein Baby war, sondern ein Säugling. Diese historische Schludrigkeit störte mich beim Lesen zunehmend, vor allem, da sie in unangenehmen Widerspruch liegt zur ganz klassischen Marmoraufmachung des Buches.
Glaube ich an Schicksal, Fügung und Zufall? Eigentlich nicht, und auf jeden Fall nicht mehr als Wilkie Collins. Aber der Zufall wollte es, dass der Tag, an dem ich nach so vielen Jahren endlich Das Geheimnis des Myrtenzimmers las, genau auf den 183. Geburtstag des Autors fiel. Und als ich das erkannte – da war ich sogar bereit, ihm sogar das allzu zufällige Aufeinandertreffen von Sarah und Rosamund in dem kleinen Seebad zu verzeihen.
Zeit, auch Die Frau in Weiß noch einmal zu lesen. Und natürlich den Roten Schal.