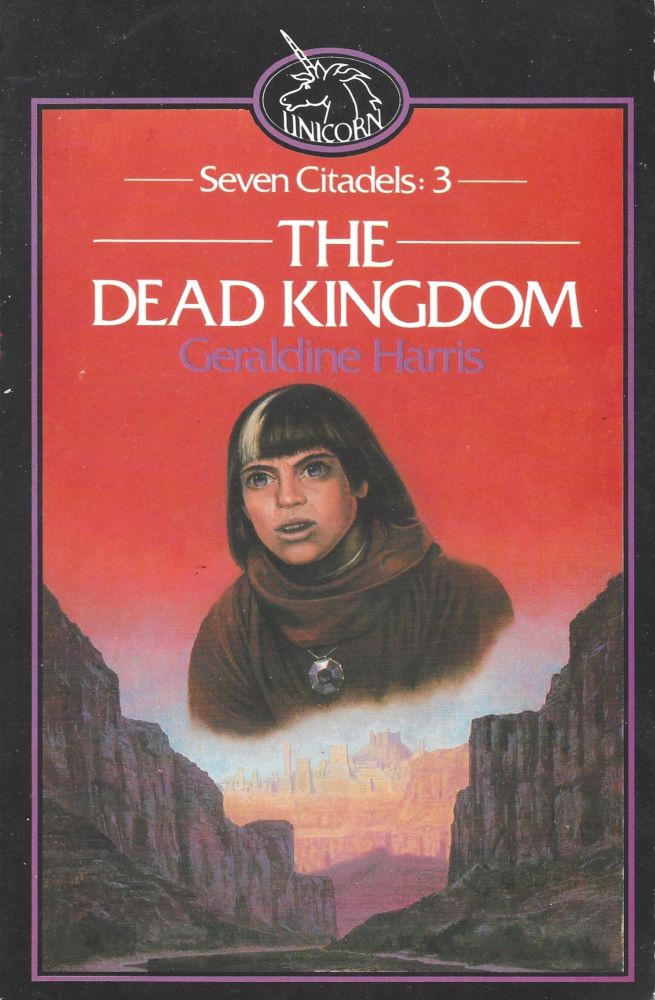Der dritte Band der Seven Citadels ist mit nur 182 Seiten der kürzeste Teil der Tetralogie – für die Lektüre habe ich aber bis jetzt am längsten gebraucht. Zu episodenhaft fühlt sich das Buch an, das vor allem gegen Ende massiv an Fahrt verliert, und die Etappen der Reise, die Kerish-lo-Taan und seine Gefährten zurücklegen müssen, wirken seltsam disjunkt. Alles in allem hatte ich das Gefühl, Harris hätte Probleme gehabt, ihre vom Verlag vorgegebene Mindestlänge zu schaffen, und Seiten schinden müssen, um das Buch noch irgendwie vollzukriegen, und nach dem sehr starken zweiten Band hat der dritte Teil dann leider ein wenig nachgelassen.
Das Königreich der Schatten, die deutsche Ausgabe von The Dead Kingdom, war einer der allerersten Fantasyromane, die ich besessen habe, seit ich das Buch gegen Ende der Achtzigerjahre in der Wühlkiste bei Woolworth erstanden habe – damals neben der Stadtbücherei die einzige Quelle für die bei Goldmann und Heyne verlegten Reihen, denn die beiden Buchhandlungen meiner heimatlichen Kleinstadt führten keine Fantasy. Ich kaufte das Buch, ohne mich damit aufzuhalten, dass es bereits der dritte Band eines Mehrteilers war – es kostete nur irgendwas um die zwei D-Mark, und ich hatte die Hoffnung, den Rest der Reihe schon irgendwie zusammenzubekommen. Das sollte zwar noch Jahre dauern – in der Zwischenzeit hatte ich mir in der Stadtbücherei den Sammelband ausgeliehen und gelesen – aber am Ende hat es ja tatsächlich geklappt.
Jetzt habe ich also, im Verlauf von fünf Tagen, dieses Buch zum dritten Mal gelesen. Und es fällt mir schwer, nachzuvollziehen, wie ein so kurzes Buch, in dem so viel passiert, dabei solche Längen haben kann. Denn passieren tut wirklich viel: Kerish und Co. können am Ende nicht weniger als drei Zitadellen von ihrer Liste abhaken, sind einmal quer um die Welt gereist, haben dem untoten Magierkönig Shubeyash und seinem ganzen verfluchten Land das Licht gezeigt und sind auf dem Weg zum siebten und letzten Schlüssel – aber das Pacing stimmt einfach nicht richtig.
Gerade das namensgebende tote Königreich Roac kommt erstaunlich kurz, kaum sind sie angekommen, sind sie auch schon wieder fertig, nur um im hinteren Drittel des Buches wochenlang bei dem geschwätzigen Magier Vethnar in dessen Zitadelle zu versacken und sich endlosen Disputen hingeben zu müssen, die, anders als die im ersten Teil noch viel zu stark gestrafften Dialoge, auch seitenlang ausgeschrieben werden – hier hätte Harris‘ Lektor:in den Rotstift ansetzen müssen, aber dann wäre das Buch noch kürzer geworden und hätte vielleicht die Vorgaben nicht mehr erfüllt.
Dazu kommt, dass der einstmals so arrogante Dritte Prinz ein gutes Jahr nach Aufbruch sehr viel an Selbstbewusstsein eingebüßt hat. Nicht nur ist er damit zu weise und abgeklärt für seine inzwischen neunzehn Jahre: seine Selbstreflexion grenzt schon fast ans Weinerliche, wenn sich Kerish für gänzlich unliebenswert hält. Der Bruderzwist mit Forollkin kocht nicht mehr hoch wie in The Children of the Wind, weil Kerish immer gleich einen Rückzieher macht und meint, dass man ihn ja sowieso hassen müsste – und alles, weil Cousine Gwerath ihre Gefühle für Forollkin nicht länger verstecken möchte und Kerish damit nicht zurechtkommt. Dabei wirkt es nicht so, als ob Kerish selbst in Gwerath verliebt wäre: Selbst seiner Katze scheint er tiefere Gefühle entgegenzubringen, und allein die Tatsache, dass sie einen anderen vorzieht, kränkt sein fragiles Ego und macht ihn unsympathisch.
Gwerath hingegen, mit der ich im zweiten Band noch nicht so viel anfangen konnte, macht im dritten eine interessante Entwicklung durch. Sie muss lernen, dass die Göttin, der sie ihr Leben lang Priesterin gedient hat, in Wirklichkeit eine der Zauberinnen war – und dass Kerish und Forollkin als diese nicht unerhebliche Tatsache vor ihr geheim gehalten haben, um ihre Gefühle oder ihr Weltbild nicht zu verletzen. Als einzige Frau der Gruppe wird sie vor allem anfangs weggeschickt, sobald es gefährlich wird – obwohl beide Gottgeborenen wissen, dass sie sich durchaus ihrer Haut zu wehren weiß. Ihre Versuche, sich zu verbiegen, um Forollkin, der erst einmal nur Augen für die Königin des matriarchalisch regierten Landes Seld, in dem Männer nur Dekoobjekte sind, hat, sind schmerhaft – und als sich Gwerath und Forollkin dann doch endlich näherkommen, wirken dessen Beteuerungen, er möge sie doch als sie selbst am meisten, ein bisschen unglaubwürdig: Im Vergleich zu den zahlreichen Malen, die beschrieben wird, wie er von Königin Pellameera schwärmt, bekommen wir wenig Liebesbekundungen von Forollkin an die wildhaarige, wie ein Junge gekleidete Gwerath zu sehen.
Das kann auch daran liegen, dass Forollkin in diesem Buch kaum mehr zu tun hat als eine Nebenfigur. Das Ganze ist die Große Kerish-Show, inzwischen in einem Maße, dass es mich stört – ich bin Rollenspielerin, ich mag es, wenn Heldengruppen als Team agieren, in dem jeder mal etwas zu tun hat und die eigenen Fähigkeiten einbringen kann, aber hier ist es Kerish mit seiner Hellsicht, Kerish mit seinem Redetalent, Kerish mit seinem moralischen Kompass, der die Probleme der Gruppe lösen darf, und seine Gefährten werden weitgehend auf freundliche Hinweisgeber reduziert. Selbst als Kerish am Ende dem Aufgeben nahe ist, reicht ein Stichwort Gidjabolgos aus, um ihn wieder auf Kurs zu bringen und den störrischen Magier zu überzeugen, Schlüssel und Unsterblichkeit aufzugeben.
Dabei hat das Buch noch wirklich stark angefangen. Die Zitadelle des gramgebeugten Zauberers Saroc wartet mit so surrealistischen Szenen auf, dass man sich in einem zum Leben erweckten Gemälde von Salvador Dalí wähnt, und bringt dabei einige echt herzzerreißende Momente mit. Da habe ich buchstäblich an den Sätzen geklebt, hatte ein Kopfkino, wie es für mich gänzlich untypisch ist, und hatte großes Vergnügen an diesem Teil des Buches. Auch der Weltenbau des (un)toten Königreichs ist stark – da will man mehr wissen über die untergegangene Kultur von Roac, wo Hände eine so große Rolle spielen, dass adlige Frauen Käfige um ihre tragen und Männer ihre Finger opfern, um der Verehrung ihres Königs Ausdruck zu verleihen.
Aber dann verkommt der Weg durch Roac immer mehr zur Geisterbahnfahrt. Links und rechts der Strecke lassen sich die Schatten der Vergangenheit beobachten wie beim historischen Reenactment, doch die Gefährten interagieren nie mit ihnen, marschieren nur durch bis ins Allerheiligste und stellen den handschuhbewehrten Shubeyash in seiner Schatzkammer, wo Kerish ein schmerzhaftes Opfer bringen muss, das ihn mit einer dauerhaft verkrüppelten Hand zurücklässt – eine Tatsache, die Kerish seltsam teilnahmslos hinnimmt, selbst wenn es bedeutet, dass er sein geliebtes Instrument nie wieder wird spielen können. Und Kerishs Nutzlosigkeit, dass er nicht mehr mit anpacken kann, bleibt nebensächlich, weil der Prinz auch vorher eher fürs Im-Weg-Herumstehen bekannt war als für seine tatkräftige Mitarbeit. So bleibt ausgerechnet Hauptfigur Kerish in diesem Buch sehr an der Oberfläche, sein Zorn, der ihn zwei Bände lang mit Leben gefüllt hat, ist verraucht, und ohne wirkt Kerish blass und hohl.
Stellenweise wirkt das Buch dann unglaubwürdig: Wenn für Kerish, auf Basis einer wirklich sehr vagen Prophezeiung, binnen weniger Wochen ein hochseetüchtiges Boot aus seltenem blauen Treibholz gebaut wird, ohne dass jemand da mal nach Geld fragt, und sich de ehemalige Hofnarr Gidjabolgo als so kundiger Seefahrer herausstellt, dass er im Handumdrehen aus dem nautisch unbeleckten Forollkin einen Kapitän machen kann, der dann auch die schwersten Gewässer meistert – das ist zu dick aufgetragen und wirkt an den Haaren herbeigezogen. Dass die Starflower dann mit nur drei Mann aktiver Besatzung (plus Kerish, der mehr wie ein Passagier fungiert) rund um die Welt fahren kann, aber genug Platz an Bord bietet, dass sie nicht alle den Koller bekommen, ist das erste Stück Weltenbau in der Reihe, das sich schlecht recherchiert anfühlt und es mir schwer macht, mir das Ganze visuell vorzustellen – wie groß ist dieses Schiff denn nun? Und kann man aus Treibholz in drei Wochen wirklich etwas bauen, das für eine Weltreise ausreicht?
Regelrecht ärgerlich wird dann der Schluss des Buches. Da plätschert nach dem Aufbruch aus Vethnars Zitadelle – die ein guter Cut für das Ende gewesen wäre – noch drei Seiten lang eine ziemlich dröge nacherzählte Seefahrt dahin, nur um mit dem letzten Satz den unmotiviertesten Cliffhänger dranzupappen, den ich seit jemals irgendwo gesehen habe. Und wo die ersten beiden Teile noch ziemlich geschlossen endeten, mit einem Ausblick auf das, was folgen könnte, reißt The Dead Kingdom ab mit einem »Ätschibätsch, jetzt musst du dir auch Band Vier kaufen!« Und das zieht bei mir gerade nicht so gut, ich habe plötzlich weniger Interesse, die reihe zu Ende zu lesen und mir auch das vierte Buch zu Gemüte zu führen, vor allem, weil ich mich erinnere, dass ich den Schluss der Reihe wirklich nicht besonders gemocht habe.
Das klingt jetzt alles überkritisch, ist aber ein Jammern auf hohem Niveau. Auch wenn mir The Dead Kingdom nicht so gut gefallen hat wie The Children of the Wind, ist es kein schlechtes Buch, und die Leseempfehlung für die ganze Reihe bleibt bestehen. Nur war dies tatsächlich das erste Buch, das für mich tatsächlich ein bisschen kürzer hätte sein können statt länger. Und wie und wann ich mich dann an The Seventh Gate, den Abschlussband, mache, das muss ich erstmal schauen.