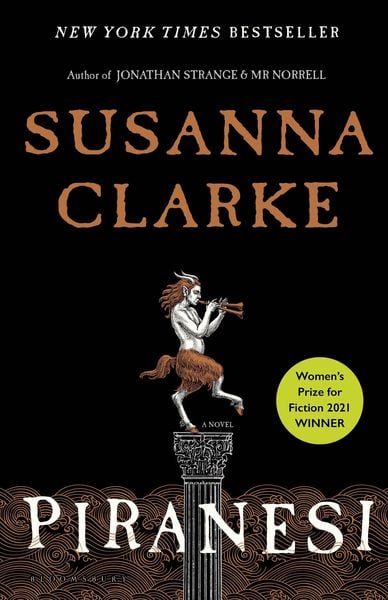Normalerweise gebe ich nicht viel auf Buchempfehlungen. Zu hören, dass jemand aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis ein Buch toll fand, führt üblicherweise dazu, dass ich selbst Probleme habe, es zu lesen, zu voreingenommen bin ich durch die Erwartungshaltung, die plötzlich an der Lektüre ist: Wenn ich dieses Buch nicht mag, enttäusche ich dann nicht ganz furchtbar die Person, die es mir empfohlen hat? Ich mag es, derjenige zu sein, der ein Buch entdeckt, ich freue es, wenn jemand auf einen Tipp oder eine Rezension von mir ein Buch selbst lesen mag, aber umgekehrt funktioniert es nicht gut. Und doch: Als ich kürzlich das Fürimmerhaus las und im Lesezirkel meines Autorenforums davon erzählte, und mir daraufhin das Buch Piranesi empfohlen wurde (Lieblingsbuch, auch das noch!), habe ich keine Sekunde gezögert, es mir bestellt und, als es dann da war, postwendend gelesen. Und, was soll ich sagen – Lieblingsbuch trifft es.
Man kann sich fragen, ob Kai Meyer mit seinem Fürimmerhaus bei Susanna Clarkes Piranesi abgeschrieben hat, zu ähnlich klingen die Prämissen beider Bücher: Häuser, die in ihrer Ausdehnung kein Ende nehmen wollen, die endlosen Hallen und Gänge gesäumt von abertausenden Statuen, das ist schon sehr spezifisch, und das haben wir in beiden Büchern. Aber vom Zeitplan her kann es nicht hinkommen – Piranesi ist im September 2020 erschienen, das Fürimmerhaus ziemlich genau ein Jahr später, und wenn ich schaue, wie viel Vorlaufszeit ein Verlag braucht, ein Buch herauszugeben, und ein Autor, es zu schreiben, kann ich mir höchsten vorstellen, dass Meyer sich von einer Ankündigung von Piranesi hat inspirieren lassen, etwas ganz Eigenes aus der gleichen Idee zu machen.
Denn aus der Nähe betrachtet haben die beiden Bücher dann gar nicht mehr so viel gemeinsam, von der ähnlichen Architektur abgesehen. Im Fürimmerhaus dominieren die Actionszenen, brutale Schlachten und dramatische Fluchten. Piranesi ist ein langsames, psychologisch herausforderndes Buch. Eines, das sich ins Hirn wurmt und dableibt, das einen noch lange nach Ende der Lektüre ans Denken bringt, und es war dasjenige der beiden Bücher, das mich wirklich von vorne bis hinten überzeugen konnte. Wenn ich es mit einem anderen Buch vergleichen müsste, dann mit William Sleators Haus der Treppen – beide spielen an einem surrealistischen, niemals endenden Ort, beide gehen psychologisch unter die Haut, und beide sind von der Sorte, an die man sich noch lange danach erinnern wird. Bücher, nach denen man Redebedarf hat. Bücher, die man unbedingt weiterempfehlen muss, damit sie das, was sie mit einem selbst gemacht haben, auch mit anderen Leuten machen können.
Piranesi scheint meine Rezension zum Fürimmerhaus gelesen zu haben und mir dann genau das gegeben, was ich am ersten Buch vermisst habe: Da habe ich mich beklagt, dass man kein Gefühl für den Alltag im Haus bekommt, beginnt das Buch doch mit einem Umsturz und Aufbruch, den man nicht wertschätzen kann, weil der Vergleich fehlt. Hier hingegen wird der Alltag im labyrinthartigen Haus fühlbar, macht sich vertraut, bevor langsam das Neue, das Fremde in die Handlung eindringt. Nicht das Haus selbst verändert sich, sondern die Wahrnehmung, und wie das Buch mit der Perspektive spielt, ist meisterlich.
Icherzählungen steigen und fallen mit der Originalität ihrer Erzählstimme – und mit deren Horizont, über den man als Leser niemals hinausblicken kann. In der Icherzählung gibt es keinen Allwissenden, keine Außensicht, die Kamera kann nicht mal eben in die Totale zoomen, sondern man sitzt auf Gedeih oder Verderb im Schädel einer einzelnen Figur, kann nur da hinschauen, wo sie hinschaut, und das nicht nur räumlich betrachtend, sondern auch zeitlich. Hier ist der Erzähler – Piranesi genannt, obwohl er sich sicher ist, dass das nicht sein Name ist, aber irgendwie muss der Andere ihn ja nennen – sehr stolz auf sein gutes, ja nahezu perfektes Gedächtnis, das es ihm ermöglicht, sich Hunderte von Hallen, tausende von Statuen einzuprägen, jeden Weg im Labyrinth wiederzufinden. Er führt Tagebücher, er indiziert sie penibel, aber er liest sie nicht – warum sollte er auch? Er erinnert sich ja!
Und natürlich ahnt man als Leser sehr schnell, dass das nicht stimmt, dass Piranesi ganz wesentliche Sachen vergessen zu haben scheint, wie seinen ursprünglichen Namen oder die Frage, wie er überhaupt an diesen surrealen Ort gekommen ist, aber so überzeugt ist Piranesi von seiner eigenen Unfehlbarkeit, dass man ihn auch als engagiertester Leser nicht umstimmen kann. Stellenweise habe ich mich gefühlt wie die Kinder im Kasperletheater, die laut »Hinter dir!« brüllen in der Hoffnung, dass die Figur sich dann umdreht, aber er dreht sich nicht um, und wir können selbst nicht sehen, was da hinter ihm steht. So ist das Buch ein Pageturner, bei dem die Frage, was als nächstes passieren wird, beinahe überlagert wird von der Frage, was vorher passiert ist.
Selten habe ich das Thema Amnesie besser umgesetzt gefunden als in Piranesi, das graduelle Vergessen, das sich ins Leben schleicht, bis die frühere Persönlichkeit ausgemerzt ist, bis an ihre Stelle ein anderer getreten ist, der nichts mehr davon ahnt, dass überhaupt etwas verlorengegangen ist. So ist es, das Haus, es raubt denen, die sich zu lang dort aufhalten, Erinnerung und Verstand, und da muss man dem Icherzähler zustimmen: Er ist wirklich bemerkenswert gut darin, dort zu überleben, eine symbiotische Beziehung mit dem Haus einzugehen, sich nicht zu verlieren, sondern jemand anderes zu werden. So wie er in seinen Tagebüchern irgendwann eine neue Zeitrechnung erfindet, als die alten Jahreszahlen ihm nichts mehr sagen, erfindet er auch sich selbst neu.
Sollte er seine alten Aufzeichnungen lesen? Im Sinne des Lesers ist das leicht zu beantworten, aber in seinem eigenen? Ich kann sein Zögern verstehen, seine Überforderung, als er sich tatsächlich zögerlich an alte Eintragungen heranwagt. Ich habe selbst über Jahre sehr intensiv Tagebuch geführt. Die Bände stehen in meinem Bücherregal, nicht versteckt, gut sichtbar. Ich kann mich nicht dazu bringen, sie zu lesen. Zum einen erinnere ich mich ja noch an alles, das relevant war, und an eine Menge, das nicht. Wie Piranesi habe ich ein herausragendes Gedächtnis. Vor allem aber möchte ich die Person, die da vor dreißig und mehr Jahren ihre Gedanken zu Papier gebracht hat, nicht näher kennenlernen. Ich habe zu große Angst, diesen Menschen nicht zu mögen.
So schreibt auch Piranesi weniger für sich selbst als mehr für eine noch unbekannte Person, die einmal seinen Bericht lesen wird – jemand, den er noch nicht kennt, und dabei kennt er jede Person, die jemals auf der Welt gelebt hat. Alle fünfzehn. Und weil dreizehn von denen schon tot sind – Skelette, die an verschiedenen Stellen im Labyrinth zu finden sind und um die Piranesi sich mit Speiseopfern und Blumengaben kümmert – gibt es außer ihm nur noch eine andere Person auf der Welt, den Anderen. Ein Buch, das über weite Strecken mit zwei Figuren auskommt, meistens sogar mit nur einer, weil Piranesi den Anderen nur zweimal die Woche für ein Stündchen trifft – das klingt, als müsste das Buch ein Ödnis sein, und doch ist es das Gegenteil davon.
Für Piranesi ist das Haus lebendig, er ist sein geliebtes Kind, er redet mit den Statuen, auch wenn sie ihm niemals antworten, und mit den Vögeln, welche die endlosen Hallen bevölkern, und so, wie er sich niemals einsam fühlt, tut das auch der Leser nicht. Als sich die Anwesenheit einer weiteren Person – nach Piranesis Zählung der Sechzehnte – empfinde ich das als Eindringen in einen geschützten Raum, fürchte ich, dass nun nichts mehr bleibt, wie es war, und habe Angst, was die damit verbundenen Erkenntnissen aus unserem Erzähler machen werden, so tröstlich ist die Art, wie er mit sich selbst und dem Haus im Reinen ist.
Piranesi ist kein dickes Buch – kein Vergleich zu Clarkes früherem Buch Jonathan Strange and Mr. Norrell, das ungelesen in meinem Regal steht, weil ich mich an seine monumentale Länge einfach noch nicht herangetraut habe – aber dabei unglaublich dicht. Und nachdem ich anfangs ein paar Probleme hatte, in die Erzählstimme hineinzukommen und darüber gestolpert bin, dass Piranesi so viele Substantive großschreibt, die im Englischen kleingeschrieben gehören, habe ich mich doch schnell eingelesen und die Großschreibung als seinen staunenden Respekt vor seiner Umwelt akzeptiert, bis es mir irgendwann gar nicht mehr aufgefallen ist.
So habe ich nur drei Tage gebraucht, das Buch zu lesen – zwei Tage für die erste Hälfte, die zweite dann in einem Rutsch, ich mochte das Buch nicht mehr aus der Hand legen und wollte unbedingt wissen, was als nächstes kommt. Dass ich viele Wendungen richtig vorhergesehen habe – vieles, das Piranesi selbst nicht verstehen kann oder will, ist für die Lesenden doch sehr schnell klar – hat der Spannung da keinen Abbruch getan. Und doch hatte ich mit jeder Seite, die ich umgeblättert habe, mehr Angst, das Buch könnte sich in eine Richtung entwickeln, die mir nicht gefällt – nicht länger perfekt sein. Als Autor wie als Leser weiß ich, wie viel man mit einem missratenen Schluss versemmeln kann, wie man auf wenigen Seiten ein ansonsten gutes Buch runterziehen, sogar ruinieren kann, und ich hatte wirklich Angst, auf den letzten Metern enttäuscht zu werden.
Und ja, es gibt gegen Ende von Piranesi eine Zäsur – die sich aber so organisch in das Buch einfügt, dass diese Wendung – wenn auch nicht die, auf die ich gehofft hatte – zum Rest passt, sich aus dem Vorhergegangenen ergibt, und das Buch zu einem würdevollen Abschluss bringt. Auch wenn ich selbst das Buch hätte anders ausgehen lassen: Ich verstehe die Absicht der Autorin, ich kann sie nachvollziehen, es ist ein stimmiger, würdevoller Schluss, der genug Fragen offen lässt, um die Rädchen im Kopf am Rotieren zu halten. Trotzdem musste ich, nachdem ich die letzten Seiten gelesen hatte, erst einmal innehalten und mich fragen, ob ich den Schluss so mag. Ich vermeide üblicherweise, mir Rezensionen anzuschauen zu einem Buch, das ich noch lesen will, und hier hatte ich im Vorfeld schon mehr gehört, als mir persönlich lieb war, darunter Lob über Lob für den Schluss, und ich glaube, ich hätte selbst wirklich ein anderes Ende bevorzugt.
Aber es ist nicht schlecht, wenn mich ein Buch über die Lektüre hinaus beschäftigt. Wenn man es im Kopf dreht und wendet, in verschiedene Stellen nochmal reinzoomt um sie, in Anbetracht späterer Ereignisse, nochmal zu beleuchten, und sich dabei ertappt, wie man selbst durch die Hallen wandert und sich die Statuen anschaut. Es ist, was das betrifft, ein sehr visuelles Buch – stellenweise habe ich mich zurück ins Innere des Völkerschlachtdenkmals mit seinen Reihen über Reihen von Statuen erinnert gefühlt, und an das Unbehagen, das ich an dem Ort verspürt habe: Piranesi lässt einen denken und fühlen, spült eigene Erinnerungen nach oben und macht Dinge im Kopf, die hinterher nicht mehr weggehen wollen.
Als ich Anfang des Jahres The Gilded Crown gelesen habe, war ich noch überfordert damit, wie mich das Buch ans Fühlen gebracht hat, wie es all diese negativen Emotionen in mir zum Vorschein gebracht hat: Ich musste das Lesen überhaupt erst wieder lernen, die Dinge, die ein Buch mit einem machen kann, und vor zwei Monaten hätte mich wahrscheinlich auch Piranesi überfordert. So aber ist es das fünfzehnte Buch, das ich in diesem Jahr lese – wie treffend: Ein Buch für jeden Menschen, der jemals gelebt hat! – und ich habe wieder gelernt, mich bewegen zu lassen. Und obwohl Piranesi nahezu komplett ohne Action auskommt, packt es einen doch mit der Macht von vier Gezeiten, die gleichzeitig über die statuenbewehrten Hallen hereinbrechen.
Von mir gibt es für dieses Buch eine ganz klare Leseempfehlung. Und wenn ihr Bücher, die euch jemand empfohlen hat, nicht gut lesen könnt: Macht eine Ausnahme. Lest es trotzdem. Und lasst zu, dass ihr darüber euren Verstand verliert und als jemand anderes herauskommt. Dieses Buch kann man nicht ungelesen machen. Und ich denke, es wird mir auch auf Jahre noch im Gedächtnis bleiben.